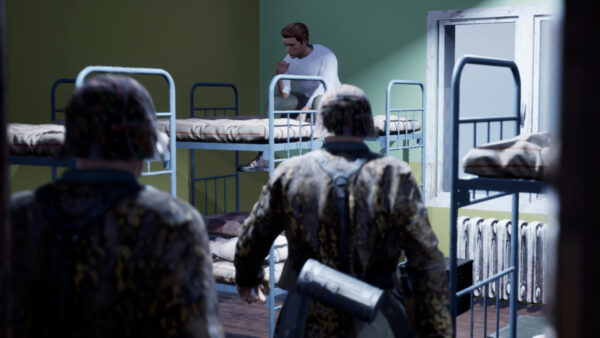Gerd Ehrlich, im Juni 1922 in eine jüdische Berliner Familie geboren, erlebt als Schüler der jüdischen Privatschule Dr. Leonore Goldschmidt den Novemberterror 1938 in Berlin:
»An den Brandstellen und vor verschiedenen zerstörten Läden stauten sich die Menschen und besahen sich die Sache. Ich mischte mich unter sie und muss zur Ehre der Berliner gestehen, dass ich nicht ein Wort der Billigung für diese Gewaltaktion gehört habe. […] Zum Mittag war ich wieder zu Hause und berichtete meinen Eltern, was ich gesehen und gehört hatte. […] Wir sprachen noch, als das Telefon läutete. Die Frau eines Mandanten rief an, ihr Mann sei eben vor zwei Gestapo-Beamten verhaftet worden: Ob mein Vater nichts unternehmen könne? Mein Vater versprach, sein Möglichstes zu tun. Kurze Zeit später kam eine jüdische Nachbarin und bat dasselbe. Dann gab es noch verschiedene Anrufe, aus denen allen klar hervorging, dass eine große Verhaftungswelle von Juden, meist wohlhabenden, im Gange war. Meine Mutter bat meinen Vater, das Haus zu verlassen und zu arischen Freunden zu gehen. Der alte Herr lehnte das mit der Begründung ab, dass er sich keiner Schuld bewusst sei und also nichts zu fürchten hätte.«
Hintergrund:
Ab 1940 muss Gerd Ehrlich Zwangsarbeit bei der Firma Ehrich & Graetz leisten. Im November 1942 wird seine Familie nach Auschwitz deportiert, er selbst taucht unter.
Im Herbst 1943 gelingt ihm die Flucht in die Schweiz. Noch in Genf schreibt er im Winter 1945 einen Bericht über seine Zeit im Untergrund während des Krieges in Berlin. 1946 wandert Gerd Ehrlich in die USA aus, wo er 1998 verstirbt.
Die Geschichte des Berliners Gerd Ehrlich wird im kommenden Jahr als 26. Band der Zeitzeugenreihe der Stiftung Denkmal veröffentlicht.
______________
Bildnachweis Foto: Passfoto von Gerd Ehrlich als Zwangsarbeiter bei Ehrich & Graetz AG, Berlin, Dezember 1942; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. FOT 89/500/110/002